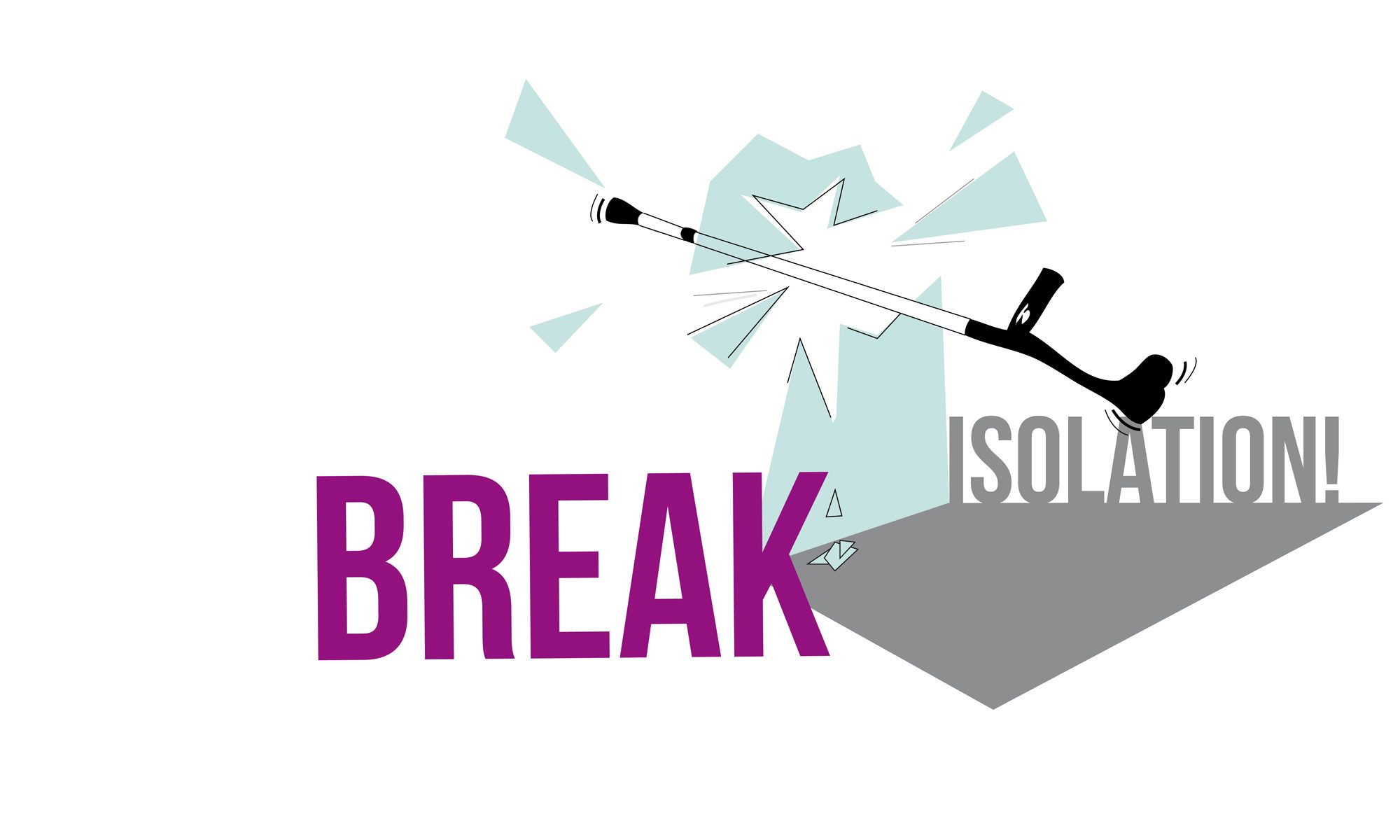Der erste Besuch: 6. bis 16. Juli 2020 vor dem Brand
Moria, das größte europäische Flüchtlingslager. Ein Ort, an dem beim Ankommen so vieles zu Ende zu gehen scheint und an dem doch so vieles weiter besteht: Der Krieg oder die Verfolgung in der Heimat, die lebensgefährliche Flucht, aber auch Hoffnung und Illusionen auf ein schöneres, besseres Leben in Sicherheit in Europa. Ein Ort, der einem das Blut in den Adern nicht nur stocken, sondern regelrecht gefrieren lässt und auch ein Ort, der jeglichem scheinbar emotional Konträrem ein Gesicht im voneinander Untrennbaren verleiht, es nach außen Gestalt werden lässt. Man könnte über dieses Flüchtlingscamp unendlich viel berichten, sich währenddessen aber immer im Zustand des absoluten Nichtwissens befindend, denn die Tragödien, die sich dort abspielen, auf denen dieses Lager im Verbrechen an Menschenleben errichtet wurde, haben weder Anfang noch ein Ende und erschüttern zutiefst das Bild eines solidarischen Europas, das in steter Bemühung von den Verantwortlichen weiter in den Köpfen unserer Gesellschaft bunt ausgemalt werden soll.
Ich durfte Menschen begegnen, die es herzzerreißend zäh und unendlich tapfer mit ihrer Realität aufgenommen haben, die die unglaubliche Größe besitzen durch den Hass und das Leid, das sie tagtäglich zu spüren bekommen, nicht zu erblinden, sondern stets den Schmerz ihrer Mitmenschen sehen, aber auch jenen, für die es keinen Fluchtweg aus der brutalen Realität und auch kein Träumen in eine friedvolle Welt mehr zu geben scheint und die sich somit auf unsolidarische Pfade begeben haben.
Menschen, deren Schicksale schon bevor sie europäischen Boden betraten und in Moria strandeten, unvorstellbar leidvoll waren, gingen diesen lebensgefährlichen Weg nach Griechenland voller Hoffnung auf eine sichere Zukunft und trauten sich wahrscheinlich in ihren schlimmsten Alpträumen nicht zu fürchten, an welchen Ort des Grauens sie ihre eigenen Füße tragen und später dann Schlauchboote bringen werden. Ein ehemaliges Militärgelände, das mittlerweile aus allen Nähten platzt und sich deshalb nun in die anliegenden Olivenhaine als sogenannter „Jungle“ in alle Himmelsrichtungen kontinuierlich erweitert und ausbreitet, wurde die neue ungewisse und schutzlose Heimat zig tausender Menschen, die für manche unter ihnen zu einer noch größeren Gefahr wurde bzw. sie in eine noch hoffnungslosere Situation gestürzt hat als es ihr ursprüngliches Heimatland bereits getan hatte, das sie verließen, aus dem sie flohen. Das Lager wird von den Geflüchteten als „Hölle“ bezeichnet und ja die meisten unter ihnen gehen dort durch die Hölle, aber nicht durch jene, wie sie uns religiöse Machtfanatiker weismachen wollen, sondern durch eine eigens von Menschenhand erschaffene Hölle, die größtenteils von außen erbaut und schrecklicherweise von jenen innerhalb des Zauns, deren Herz durch verschiedenste Umstände erfroren ist, erweitert wurde. In dieser verheerenden Realität leben Kinder, Kranke, Alte, Behinderte, alleinstehende Frauen und elternlose Jugendliche ohne Aussicht auf eine menschenwürdige Zukunft -gezwungen unbestimmte Zeit ihres Lebens dort zu verbringen und ihr Leben weiterhin zu riskieren. So unterschiedlich die Begegnungen auch waren, es wird mir bei ALLEN, die in diesem Camp ausharren müssen, schon bei dem leisesten in mir aufblitzenden Gedanken über deren Zukunft Angst und Bange. Werden sie überhaupt jemals auch nur den Hauch einer Chance bekommen, ihre Zukunft mitzugestalten oder wurde und diese tragischerweise schon erschütternd hoffnungslos vorprogrammiert? Selbst den Kindern, die mit ihren kleinen nackten Füßen in die sanft wiegenden Wellen des Meeres tapsten und deren Augen dabei ein wunderbar glückseliges Leuchten hatten, wird sich deren kindlicher Wirklichkeit unaufhaltsam und Schritt für Schritt die blanke Realität aufdrängen. Zum Teil wurden sogar die kleinsten Kinder schon von dieser Realität eingeholt. Ein sehr bewundernswerter, junger Mann, der mich in seinem Container, den er mit neun weiteren ihm zuvor unbekannten Männern teilen muss, auf eine Tasse Chai einlud, brachte es auf den Punkt, als er sagte „Mein Vater lehrte mir noch, dass jeder ein Körperteil des gesamten Körpers ist und nur, wenn jeder sich mit seinen Fähigkeiten einbringt und andere unterstützt, kann man als ganzer Mensch leben. In Moria aber werden Kinder nicht zu humanistischen Menschen erzogen, sondern zu rücksichtslosen Menschen, die alle Probleme nur durch Gewalt lösen wollen und niemand anderen außer das eigene Volk akzeptieren.“ Wie Recht er doch hat. Kinder, vollkommen unschuldig und die größte Chance unserer Zukunft werden in zukünftige Chancenlosigkeit gedrängt – in den blutbefleckten europäischen Händen liegend wie das Leben meiner kleinen Freundin, der 10-jährigen Ghazel, die mit ihren Eltern und vier kleinen Geschwistern fünf Mal versuchte, die türkische Grenze zu passieren, bevor es ihnen unbemerkt gelang. Zuvor aber wurde der Vater von türkischen Polizisten ausgepeitscht, der Mutter die Zähne ausgeschlagen. Nun aber ist sie in diesem Flüchtlingslager eingesperrt, jeglicher Zugang zu sämtlicher Art von Bildung wird ihr verwehrt. Stattdessen muss sie sich um die Familie kümmern, Wäsche waschen, ihre kleinen Geschwister versorgen – ihre Mutter schwanger und an unbehandelter Epilepsie leidend, ihr Vater schwersttraumatisiert. Sie ist ihren Geschwistern eine herzergreifend wunderbare Schwester, ja Beschützerin. Dieses selbst noch so kleine Mädchen jedoch darf all diese behütende Liebe, die sie bedingungslos Schutzbedürftigeren schenkt, in ihrem noch so jungen Leben nicht erfahren, obwohl sie dies selbst auch so sehr bräuchte. Ghazel hat in ihren kurzen Leben leidvoll lernen müssen, auf sich selbst allein gestellt zu sein und nur sich selbst helfen zu können auch in einer Situation, in der sie dringend medizinische Behandlung benötigt hätte. Sie kam mit schmerzverzerrtem Gesicht zu mir, vertraute sich mir an und zeigte mir ihren schwarz verfärbten, hoch entzündeten Zahn. Ihre Eltern jedoch weigerten sich mit Händen und Füßen mit ihrer kranken Tochter einen Zahnarzt aufzusuchen. Vielleicht aus Scham und Angst auf Grund ihres Analphabetismus oder totaler Überforderung, vielleicht aber gab es auch einen noch tiefersitzenden Beweggrund? Sicher und ausnahmslos war jedoch, dass dieses kleine Mädchen ohne Begleitung der Eltern nicht behandelt wird, sei es auch noch so lebensnotwendig. Ghazel ohnmächtig ihrem Leid zu überlassen kam für mich keine Sekunde in Frage und einen klitzekleinen Funken Hoffnung in mir tragend, die antibakteriell wirkende Milch könnte diesem wundervollen Kind ein bisschen die Schmerzen lindern, lernte ich ihr den Mund zu spülen. Am nächsten Tag kam sie mir freudestrahlend entgegengelaufen, erzählte stolz, dass sie ihr Problem eigenhändig lösen konnte und zeigte mir ihre Zahnlücke. Der Zahn war verschwunden. Ghazel hatte sich ihren Zahn selbst gezogen, einen weiteren gleich mit, da dieser auch zu schmerzen begann. Wie verzweifelt muss dieses Kind gewesen sein, das dachte, ihr Zahnproblem und die damit einhergehenden Schmerzen auf diesem Weg bestens gelöst haben zu können? Diese Augen, so unglaublich schön, so tief, so welterfahren, so wissend und gleichzeitig diese unendlich schwere Last voller Wucht niederdrückend auf den zarten Schultern des Mädchens liegend. Wird diese empfindliche, schutzbedürftige Kinderseele an oder trotz diesem unsäglichen Leid wachsen können oder wie ein zierlicher Schmetterlingsflügel an den grausam starken Berührungen zerbrechen? Darf dieses liebenswürdige Mädchen, das selbstlos für Schwächere da ist, je erfahren, dass auch sie einmal schwach sein darf, sie sanft liebende Hände durchs Leben tragen werden und dürfen ihre großen braunen Kulleraugen je das Licht am Ende dieses bisherigen Weges erblicken?
Fatima, eine junge Frau, die als einjähriges Mädchen durch einen Taliban-Angriff in ihrer Heimatstadt Kunduz vom Dach ihres Hauses geschossen wurde, ein immer noch deutlich ertastbares, großes und eindeutig erkennbares Loch in ihrem Kopf davongetragen hat, ist von diesem Tag an schwerstbehindert, da sie nach diesem brutalen Angriff weder medizinisch versorgt noch behandelt wurde und auch jetzt wird ihre Epilepsie, die durch die enorme Verletzung ihres Gehirns entstanden ist, nicht behandelt und jeder Anfall bringt sie einen Schritt näher an die Schwelle des Todes. Die Mutter floh mit ihrer geschwächten, kranken Tochter von Afghanistan und schaffte wie durch ein Wunder den Weg bis hierher. Dann zerplatzte schlagartig die Hoffnung auf eine gerechte und lebensnotwendige Behandlung Fatimas wie eine Seifenblase. Der Gesundheitszustand verschlechtert sich zusehends, Fatima kann keine Nahrung mehr zu sich nehmen, es haben sich halbmondförmige Hämatome an beiden Nieren gebildet was dazu führt, dass sich ihr kraftloser Körper zunehmend selbst vergiftet. Wird sie den morgigen Sonnenaufgang noch sehen, das Rascheln der vom Wind angepusteten Olivenblätter noch hören dürfen? Hier in Moria ist sie, wenn kein Wunder geschieht dem Tode geweiht und welch furchtbare und schmerzhafte Gefühle muss ihre Mutter durchstehen, die das Beste für ihre Tochter, ihr eine gute medizinische Versorgung und dadurch ein für sie gutes Leben ermöglichen wollte, den lebensgefährlichen Weg mit Fatima auf sich nahm und nun ohnmächtig zusehen muss, wie dem Körper ihrer eigenen Tochter langsam aber sicher das Leben entweicht?
Der 18-jährige Farid, ein junger Afghane mit feurig, brodelnden Augen und markant harten Gesichtszügen kam in einem neun Meter langen Schlauchboot mit weiteren 51 „Passagieren“ an Board auf Lesbos an und hatte Glück die Insel unversehrt erlangt zu haben, da das Boot nicht wie normalerweise mit 70 Personen besetzt war. Kurz bevor sie das Festland erreichten, stieß das Boot an einen Felsen, Farids Schwager ging über Board, er sprang ohne auch nur einen Augenblick zu zögern hinterher und rettete ihn ans Ufer. Ein junger, energiegeladener Mann, der unermüdlich eine NGO vor Ort als „Volunteer“ unterstützt, bekam zusehends das Gefühl, vergessen, nutzlos und aussichtslos verloren zu sein und schloss sich der campinternen Mafia an in der Hoffnung Anerkennung und Berechtigung für sein Dasein zu finden. Sein Job ist nun alleinstehende Frauen im Camp aufzusuchen und an den selbstorganisierten Prostitutionsring zu verkaufen, sowie nachts loszuziehen um Schafe der griechischen Bauern auf deren Feldern zu schlachten, damit das Fleisch auf dem internen „Moria-Markt“ an die Geflüchteten verkauft werden kann. Farid, der seine Schwester über alles liebt, sie beschützt und verehrt, der auch mir als Frau sämtliche schwere Kisten selbstverständlich schleppen half, geriet in diese gefährlichen, strukturellen Fänge skrupel- und herzloser Menschen ohne zu realisieren, welch enorm großes Unheil er anrichtet, wie vielen diesen gewalttätigen Verhältnissen ausgelieferten Frauen er dadurch unverzeihlich zerstörerisch Körper und Geist raubt. Viele von ihnen mussten aus ihren Heimatländern fliehen, da sie dort von klein auf als sexualisierte Ware benutzt wurden und noch nie in ihrem Leben erfahren haben, dass sie als Frau ein Recht auf Unversehrtheit und ein selbstbestimmtes Leben. Andere flohen ohne Mann ganz allein, um ihre behinderten Kinder vor der Ermordung in ihrer Heimat zu retten und nun sind sie derselben unmenschlichsten Gefahr in diesem europäischen Flüchtlingslager schutzlos ausgeliefert, da – wie sollte dies auch möglich sein -, die Zelte, in denen sie hausen, keinerlei Schutz vor Gewalt und Zutritt von außen gewähren können und auch der „Jungle“ weitläufig genug ist, um Frauen unbemerkt zu verschleppen. Gesucht werden sie hier von niemanden. Wird Farid sich aus hoch kriminellen und gefährlichen Machenschaften befreien und lösen können, wird in ihm ein Keim der Hoffnung und Perspektive je wieder aufblühen können, sodass sein Herz, das im Grunde so sehr für andere schlägt, wieder auf seinen ursprünglichen Weg zurückfinden kann? Ich kann es nicht beweisen, aber ich bin der Ansicht, dass dieses Lager, das immer noch als „Durchgangscamp“ deklariert wird, nie als solches gedacht war und je länger ich mich dort aufhielt, desto mehr beschlich mich das ungeheure Gefühl, dass die angebliche „Masseneinwanderung“ gestoppt werden soll, indem der Zukunft und teils dem Leben der Menschen im Camp ein jähes Ende gesetzt werden, damit es sich bis in jedes abgelegene Dorf dieser Welt herumspricht. dass Europa nie eine Heimat für Menschen in Not war, ist und sein wird. Dieses Lager breitet sich immer weiter in den umliegenden Olivenhainen aus, in denen unter freiem Himmel weder Frauen noch Kinder irgendeinen Schutz gewährt bekommen, sämtlichen Gewalten – ob natürlichen oder menschlichen – vollkommen ohnmächtig ausgeliefert sind und auch die Sicherheit auf dem Militärgelände ist weder ein ernstes Anliegen der Ausführenden noch gewährleistet. Polizisten und Soldaten sind nur tagsüber und in gehöriger Unterzahl dort anzutreffen, scheinen sich ihrem eigentlichen Auftrag auch nicht immer bewusst zu sein und keine präventive, deeskalierende Ausbildung genossen zu haben. Rettungswagen sind frühestens 30 Minuten nach Eingang des Notrufs vor Ort, dürfen das Gelände aber nicht befahren, sodass ich miterlebt habe, wie eine kollabierte und eine in den Wehen liegende Frau über Stock und Stein geschliffen wurden, um an den Eingang des Camps gebracht zu werden und in die Hände der Notfallmediziner gelangen zu können. Noch dazu haben diese Menschen, die auf ihrer Flucht in ein besseres Leben noch immer aufgehalten werden keine Möglichkeit, die örtliche Polizeistation aufzusuchen, wenn sie nicht vorher einen Berechtigungsschein der internen Camp-Polizei ausgestellt bekommen haben. Nachts sind sich die Menschen in dem Camp völlig selbst überlassen, das Zelt einer sechsköpfigen Familie wurde von deren Nachbarn, der sich von der Mutter abgewiesen fühlte, angezündet, ein Mann aus Afrika wurde während dem Versuch einem Mann aus Afghanistan das Handy zu stehlen, von diesem erstochen und verblutete. Dies sind nur zwei Vorfälle, die ich während meiner Zeit dort erfahren habe. Es geschehen jedoch unzählige dieser Art Nacht für Nacht oftmals auch in totaler Verschwiegenheit. So viele Todesfälle und Vergewaltigungen wären vermeidbar, so viele Menschenleben könnten gerettet und vor körperlicher oder psychischer Versehrtheit bewahrt werden. Nur ist das auch Ziel und die oberste Priorität der Verantwortlichen? Hat sich auch nur einer oder eine der Herren und Damen Politiker auch nur eine Sekunde darüber Gedanken gemacht, was diese – ich unterstelle ihnen- bewusste Handlungsweisen gegenüber den geflohenen Menschen auch an verheerend üblen Folgen für Europa mit sich bringen können? Und ich spreche hierbei nicht nur von der totalen Isolation, die jetzt im Deckmantel „Corona“ auf unbestimmte Zeit verschärft wurde, vom fehlenden Zugang zu sanitären Anlagen, Bildungsmöglichkeiten oder einem sicheren Dach über den Kopf. Man braucht hierfür kein Psychologiestudium durchlaufen zu haben um dies erahnen zu können. In Anbetracht dieser für die betroffenen Menschen unwürdig geformten Zustände, ist das Plakat, auf dem eine breit grinsende Ziege und die Schriftzüge „FULL OF HOPE“, „Happily I`m jumping around“ abgebildet sind und das an den Eingangszäunen des Camps aufgehangen wurde, wohl kaum noch an Zynismus zu überbieten.
Ich durfte Kindern, Frauen, Alten, Kranken und Jugendlichen, die wie Schiffbrüchige innerlichen und äußerlichen Stürmen ausgesetzt sind, begegnen. Für jeden hat das Leben eine eigene, tragische Geschichte in ihren bisherigen, teils noch so jungen Lebensjahren geschrieben und doch verbindet sie im Kern eine gemeinsame Geschichte, die mein Herz auf tragisch schöne Weise bereicherte, überraschte und überwältigte und durch die ich wieder einmal unendlich wertvolle Bilder in, durch und mit den Geflüchteten sehen und für und über das Leben lernen durfte. Eines wurde mir hier wieder äußerst eindringlich bewusst: Wir alle sind verantwortlich für die Zukunft all unserer Mitmenschen und somit auch unserer eigenen. Werden wir uns unsere Zukunft überhaupt gestalten können, wenn und während wir dabei zusehen, wenn anderen Menschen die Zukunft geraubt wird? Werden wir weitergehen können, während wir andere Menschen auf dieser Welt auf der Strecke liegen lassen? Vieles in unserem Leben lässt sich nicht beeinflussen – so sehr wir es uns manchmal auch wünschen mögen -, aber wir müssen dringend wieder zu unserem Herzen, das wir vor fünf Jahren noch bedingungslos, den bei uns ankommenden Menschen geöffnet und geschenkt haben, schnellstmöglich zurückfinden und wieder herzsehend erkennen, dass das wenige, doch so bedeutende, das in unseren Händen liegt auch mit uns wächst oder eben scheitert. Jedes freudestrahlende Lächeln eines Kindes ist zugleich unseres, aber auch jener Lebensabend einer 86-jährigen Frau, die zuerst den gefährlichen Fluchtweg noch zu Fuß auf ihren gebrechlichen Beinen bestritt, anschließend bis auch das letzte ersparte Geld aufgebraucht war, von einem Pferd weitergetragen und den letzten Teil dieser beschwerlichen Reise von ihrem Neffen auf dessen Schultern über die Berge gebracht wurde. Nun sitzt sie tagein, tagaus, nur noch eine Hülle Körper seiend, dem es nicht mehr gelingt das Leben einzuatmen und mit erloschenen Augen auf den Steinen vor ihrem Zelt die letzte Station ihres Lebens ab, in dem sie sicherlich mehr als wir jemals leisten werden müssen, geleistet hat. Ja, auch dieser Lebensabend ist zugleich auch unser eigener. Wir müssen erkennen, dass wir voneinander nicht zu trennen sind und gemeinsam die Wellen nicht beeinflussen können, doch das Ruder in unseren Händen liegen haben. Zumal sich dort zusätzlich zu einer menschlichen auch noch eine Katastrophe der Umwelt abspielt, da drei Mal täglich für rund 20.000 Menschen Mahlzeiten in Plastik verpackt geliefert werden, pro Mahlzeit an jede Familie eine Plastiktüte verteilt und jeden Tag Wasser in Plastikflaschen abgepackt für die Flüchtlinge gebracht wird obwohl eine Organisation Brunnen und Leitungen mit Trinkwasser erbaut hat. Der unverwertbare Müll weist ein enormes Ausmaß an Verschmutzung und Verwüstung der Natur auf und wäre so einfach vermeidbar. Wir können nicht länger darüber hinwegsehen oder gar sämtliche Verantwortung auf andere schieben, sondern müssen endlich selbst etwas tun und sei es nur in unserem Innersten unseren Mitmenschen wieder ein Zuhause zu geben, denn auf einen gerechten Tatendrang wie er beispielsweise scheinheilig von Herrn Laschet vorgegaukelt wurde und der dann auch noch erbärmlich kläglich darin scheiterte, brauchen wir nicht zu bauen, zu hoffen und zu warten. Freiheit und Sicherheit, wie wir sie kennen, ist nicht allein Freiheit von etwas, sondern vor allem für etwas. Wirkliche Freiheit ist angebunden an Eigenverantwortung. Wir leben hier in einem Land, in dem es leider nicht allen, aber den meisten Menschen doch ganz gut geht und wir, diejenigen, die dieses Glück haben dürfen dieses als keineswegs verständlich ansehen, wenn wir es annehmen, sondern müssen dankbar dafür sein – wohl wissend, dass dieses Geschick uns gleichzeitig auch verpflichtet. Wir sind niemals besser als andere, nur begünstigter von einem Schicksal, das wir wahrscheinlich in unserem irdischen Leben nie verstehen können und werden und deshalb sollten wir stets die Dankbarkeit bewahren und, wenn wir es vermögen zurückgeben und zwar jetzt! Die Frage nach Zeit stellt sich hier nicht mehr. Nur, wenn es uns gelingt, all das wieder tief in unsere Herzen zu verankern und es uns immer wieder ins Bewusstsein zu holen, werden wir die Welt weiterhin für uns und vielleicht ja auch zum ersten Mal für alle lebenswert gestalten und uns des Lebens auf diesem wunderbaren Planeten erfreuen können. All diese Schicksale, die stellvertretend für unzählige Menschen stehen, könnten auch unsere sein und sind es auch immer. Geflüchtete Menschen sind Menschen und keine namenlosen Zahlen, über die manchmal, wenn es gelegen kommt intensiv, oft aber auch nur beiläufig berichtet wird. Wir alle sind eins und gehören zusammen, ergeben gemeinsam einen Teil des großen Ganzen. So wie jeder Klang aus der Stille kommt und in der Stille mündet, so entspringt und mündet auch jedes Leben in der einen Quelle, wenn sie auch für jeden etwas anderes bedeuten mag.
Der zweite Besuch: vom 18. bis 25. September 2020
(10 Tage nach dem Brand)
Moria, das größte europäische Flüchtlingslager, ist abgebrannt. Nun fand auch dieses Lager ein abruptes und doch längst vorhersehbares Ende durch zerstörerisch wütende Feuerzungen, die erbarmungslos zuschlugen und all das wenige, das die Menschen dort besaßen unter ihrer Hitze schmelzend, einäschernd begruben. Das Feuer ist nach kurzer Zeit erloschen, die Frage nach der Zukunft der Geflüchteten entflammt jedoch aufs Neue. Denn die Hoffnung der Menschen, endlich diese „Hölle“ und damit die Insel Lesbos, auf der sie teils seit Jahren festgehalten wurden, hinter sich lassen zu können, wurde von der bürokratischen Kälte der EU zerstört.
Das neue, in Windeseile und fahrlässiger Unbedachtheit errichtete Lager liegt in mitten einer Landschaft aus verträumter Zeit. Gäbe es die von weitem das Unheil erahnen lassenden Maschendrahtzäune nicht, es wäre eine Szene bukolischer Seligkeit. Der mit kleinen, grauen Kieselsteinen durch-spickte Strand, der in der Sonne in einem klaren weiß erstrahlt, die rauschenden Wellen des Meeres, der Blick in die Ferne, der friedvolle Himmel. Hier schmieden die Götter noch, hier ist die Welt noch nicht fertig. Und doch ist hier an diesem Ort der Himmel unnahbar fern und die Realität so nah. Sie betäubt und entwaffnet, nichts bleibt, um sich dagegen zu wehren. Sie erzwingt, ihre Nähe in jeder Nervenfaser zu spüren, um sie als das zu begreifen, was sie ist: unerträglich, unmenschlich, unsäglich, unwirklich. Als ich wieder auf Lesbos ankomme, waren zehn Tage seit dem zerstörerischen Brand verstrichen. Ich dachte, ich wäre gewappnet und gefasst, auf das, was ich dort erleben würde, hatte ich ja schließlich in den Tagen zuvor einen mich aus dem Schlaf reißenden Anruf einer jungen Frau erhalten – in dem Moment, in dem das Unglück ausbrach und seinen unaufhaltsamen Lauf nahm sowie in etlichen Videotelefonaten und unzähligen Nachrichten mit den betroffenen Menschen einen Einblick, ja eine Vorstellung bekommen, war „live“ dabei, als auf dem besagten Lidl-Parkplatz meine Freundin R. mit mir telefonierte, mir per Handy zeigte wo sie nun hausen, als sie plötzlich ins Telefon schrie und wegrannte. Die Polizei schoss mit Tränengas auf die völlig verzweifelten, verängstigten und wehrlosen Menschen. Und doch sog mich das nun einen scheinbar den Höhepunkt erreicht habende Leid der Geflüchteten machtlos ausgeliefert zu ihnen in diesen alles verschlingenden höllischen Schlund. Die Straßen rund um das neue Lager sind undurchdringlich versperrt, es gibt kein noch so winziges Schlupfloch und zum ersten Mal ist ein durchdachtes Sicherheitskonzept der griechischen Polizei eindringlich spürbar. Hunderte Menschen machen sich verzweifelten und zugleich hoffenden Schrittes auf den Weg ins alte Lager. Viele von ihnen suchen unter dem Schutt nach übrig gebliebenen Habseligkeiten und finden letztendlich doch nur alte Tomatenkisten, die sie mit tief schwarz verkohlten Teekannen oder Wasserkanistern und mit von Brandlöchern durchbohrten Decken bepacken, dann die Schnürsenkel von ihren zum Teil viel zu großen und unbesohlten Schuhen trennen um zu einer Schnur zusammen zu knüpfen, die sie an die Kisten knoten, damit sie all das nicht den Kilometer langen Rückweg tragen müssen, sondern hinter sich her ziehen können. Manch einem gelingt es sogar noch einen alten Müllcontainer zu finden, diesen zu befüllen und ins neue Lager zu schieben. Einige der Menschen aber erwecken den Eindruck, als würden sie zu diesem Ort zurückkehren, um endgültig Abschied zu nehmen. Abschied von was? Von einer irdisch höllischen Realität, die sie ihr Zuhause nennen mussten? Es ist unfassbar schwer zu verstehen, aber ja: Sie verabschieden sich genau davon in unendlicher Traurigkeit und Verzweiflung. Die Mutter eines sechzehnjährigen Mädchens, die beide fast unentdeckt zwischen Müllbergen und Ascheresten im verdorrten Gras vor einem leeren Kanister sitzen, erzählt mir mit brüchiger, kraftloser Stimme, dass sie ihr Zuhause nicht verlassen wollen. Ich kann es so schwer begreifen, dass dieses Menschen taktisch zermürbende Militärgelände mit all seinen Baracken eine Art Heimat sein konnte, frage nach und bitte die Frau, mich näher daran teilhaben zu lassen und mir genauer zu erzählen, wie sie dies meinte. Mit Tränen unterlaufenen, glasig roten Augen sieht sie mich an und sagt mit gebrochener Stimme: „Wir kommen aus Afghanistan und mussten schon sehr früh von dort fliehen, da mein Mann von den Taliban verfolgt wurde. Wir dachten, wir würden eine zweite Heimat im Iran finden, aber wir täuschten uns. Der Iran tat alles, um uns in einer Heimatlosigkeit knebelnd gefangen zu halten. Schließlich strandeten wir auf dieser Insel, im Lager Moria. Es ist schrecklich dort gewesen, schlimm dort zu leben, aber es wurde zu einer Heimat für uns. Zu einem grausamen Zuhause, aber es wurde zum Dach über unserem Kopf.“
Ich befürchte, diese Gedanken und Gefühle begleiten viele Menschen dort nicht enden wollend und quälend wie das unaufhörliche Pfeifen eines Tinnitus´ zwar nicht im Ohr, aber im Herzen und in mir zeigen sich die Zeilen des palästinensischen Dichters Mahmoud Darwish: „Ich lernte alle Wörter und habe sie alle zerteilt, um ein einziges Wort zu schaffen: Heimat“, die diesem Moment einen besonders bewegenden Ausdruck verleihen. Entlang der Straße, unbeobachtet von der Polizei, harren noch viele andere Menschen aus, aus Angst vor dem neuen Lager. Es bleibt ihnen nicht mehr viel Zeit. Die Polizei kündigte an, in zwei Tagen die letzten übriggebliebenen, nicht gehen wollenden Menschen mit Gewalt und Zwang ins neue Lager zu übersiedeln. Man atmet die Leblosigkeit, die Verzweiflung. So viele Augen blicken mich flehentlich an, leer geweint, aber dennoch ist es als könnte man dahinter ein Leben vermuten. Immer und immer wieder wird Menschen, die ihr Heimatland aus den verschiedensten tragischen Gründen verlassen, ja aus ihrer Heimat fliehen mussten, die Zukunft genommen. Ja auch jeder kleinste eine Zukunft erahnen lassender Hauch wird vollends zerstört, verpufft als weitere Rauchwolke und weht gen Zukunftslosigkeit dem so seidigen und so tausendfach rot aufziehenden Abendhorizont entgegen. Schon zwei Tage später bewahrheitet sich die Drohung, grell gelbe Busse fahren in Begleitung zahlreicher Polizeiautos vor. Nun ist es soweit und die Menschen werden abtransportiert, direkt in das neue Lager in unvorstellbar großer Angst vor dem ungewissen Unheil, das sie dort erwarten wird. Das sich nun abspielende Szenario versetzt meine fiebrige Intuition in einen hilflos ausgelieferten Wahn – zurück in vergangene Zeiten, der von dem Weltenzustand erzählt, der sich niemals mehr wiederholen darf, sollten sich auch noch so unfassbar bizarre Blicke auf ihn werfen und doch entstehen in mir bildhafte Gefühle einer gewissen Wiederholung dieser unnennbar grausamen Zeit. Dieses Geschehen ist so schwer zu ertragen, ja auszuhalten, dass es meinen bleischweren Beinen nicht mehr gelingt davon zu laufen, da jeder Muskel in gefesselten und gelähmten Zustand versetzt wurde. Zusammengetragenes Hab und Gut wird gemeinsam mit den Menschen in die Busse verladen. Ein Polizist fordert mich höflich auf, ich möge doch bitte auch Geflüchtete in meinem Auto ins neue Lager transportieren. Nein, nein und nochmals nein: es ist mir unmöglich, mein Innerstes sträubt und wehrt sich so sehr, dieser Aufforderung nachzukommen obwohl mir stets bewusst ist, dass die Menschen auch dort in der Wildnis nicht überleben werden und können. Und es sowieso keinen alternativen Ausweg für sie gibt. Ich stehe wie gelähmt in Mitten des Geschehens, unfähig auch nur irgendetwas zu tun. Bis mir ein junger syrischer Mann auffällt, der einen Hundewelpen auf seinem Arm trägt und zusammengekauert und wispernd auf der Straße sitzt. Der Babyhund: so klein, mit noch verschlossenen Augen, so gebrechlich und zart, so schutzbedürftig und der syrische Mann: so einsam, so verzweifelt, so todtraurig, so allein gelassen. Es ist als hätten sich die Beiden gefunden, als hätten die Beiden aufeinander gewartet um sich gegenseitig am Leben halten und um dieses katastrophale Schicksal überleben zu können. Dem Mann wird die Mitfahrt in dem Bus verweigert, da der Busfahrer keinen Hund an „Board“ duldet. Seine wenigen, übriggebliebenen und ihm wichtigen Sachen jedoch befinden sich in dem Fahrzeug, er hätte somit den Kilometer weiten Weg zu Fuß gehen müssen. Dem so athletisch aussehenden Mann aber war zuvor schon längst jegliche Kraft aus seinen Beinen entschwunden. Mit zitternd schlackernden Knien müsste er diesen Marsch auf sich nehmen, ungewiss sein „Gepäck“, das mühevoll zusammengesuchte Überlebensnotwendige, wiederzufinden bzw. wiederzuerlangen. Da wird mir schlagartig bewusst und klar, diesen Horror verhindern zu müssen und ich entschließe mich kurzerhand, den jungen Kerl und seinen genauso schwachen tierischen Freund mit dem Auto ins neue Lager zu fahren. Er möchte sich bedanken, ist der englischen Sprache jedoch keines Wortes mächtig. Versucht somit dankend zu lächeln. Bemüht sich so sehr. Aber wie könnte ihm dies noch gelingen? Securitys versperren den Zugang ins neue Lager für den jungen Mann und seinen Welpen, denn ein Hund habe darin nichts zu suchen, er sei illegal. Wie konnte ich auch nur ansatzweise davon ausgehen, dass man diese eine menschliche Geste zeigen würde? Der syrische Mann, nun endgültig am Rande der Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung angekommen, bekommt ungeahnt Hilfe eines jungen Afghanen, der eine rußig verdreckte Decke anbietet unter der das kleine Tierbaby versteckt hineingeschmuggelt werden könnte. Diese rasante, selbstlose Idee tröstet für Augenblicke über die Untröstlichkeit hinweg. Ich will fast aufatmen, der Mut hierzu ist mir aber zu fern. Zu sehr bestürmt mich dieser zu tiefst unmenschliche Moment mit all seinen Bildern und hörbaren Gedanken und zwingt mich DA zu sein inmitten dieser grausamen Realität. Dennoch bin ich nicht stark genug um dieses erbarmungslose Geschehen weiter miterleben zu können. Ich laufe weit weg. Die Angst um den Mann und seinen kleinen Freund, die einander so sehr brauchen um überhaupt noch eine Überlebenschance zu haben, lässt mich tagelang nicht mehr los. Wird das Schicksal es mit den Beiden wenigstens einmal gut meinen, ihnen wohlgesonnen sein? Kann dieser syrische Mann noch von einer besseren, menschlichen Zukunft träumen? Gelingt es ihm überhaupt noch sich mit seinen Träumen zu versöhnen oder wurde ihm gar schon das Träumen geraubt? Ich befürchte nie erfahren zu können welches Ende diese Horrorgeschichte finden wird. Manche Tage schlagen ein wie ein das Herz zu spalten drohender Blitzschlag und es zeigt sich mir auf meinem Rückweg ein Bild, das treffender für diesen Tag nicht mehr hätte sein können. In der Dunkelheit, die Sonne sich schon längst hinter den Felsen ruhen und schlafen gelegt, liegen plötzlich auf der Straße direkt vor dem in der Nacht sich noch geisterhafter offenbarenden Moria drei tote Ratten auf die rechte Seite gedreht und mit aufgeblähten Bäuchen vor mir und als ich denke, was kann an diesem Tag noch passieren, tauchen in der nächsten Kurve wie aus dem Nichts schlagartig drei bis auf die Knochen abgemagerten Kühe vor mir auf, die mich mit ihren großen, runden in knöchernen Augenhöhlen liegenden Augen anstarren. Kann sich die furchtbare Realität noch schrecklicher und bildhafter von der Wirklichkeit zeigen lassen als an einem solchen Tag? Das neue Lager scheint in seiner Entstehung direkt aus der Hölle entstiegen zu sein: Wie in sämtlichen Medien sehr schnell berichtet wurde, fehlt es hier an allem, was der Menschenwürde auch nur annähernd gerecht werden könnte. Keine Iso-Boxen, nur Zelte, die sogar noch am Strand direkt vor dem Meer aufgebaut wurden und schon bei der schwächsten Windböe aus dem Boden gehoben und beim kleinsten sich zusammenbrauenden Meeressturm überflutet oder gar weggeschwemmt werden. Kein fließendes Wasser. Wozu auch? Das Meer bietet ja ausreichend Wasser und Platz für alle darin ein Bad zu nehmen und über die zahlreichen Nichtschwimmer und vom Meer traumatisierten Menschen lässt sich leichtfertig hinwegsehen. Die Anzahl der Toiletten ist so gering, dass auf einem Open-Air-Festival mehr davon vorzufinden sind als hier. Was diese katastrophalen hygienischen Zustände an Folgen mit sich bringen werden, wird wohl jedem ungetrübt klar bewusst sein oder zumindest dämmern. Noch dazu fehlt es den Frauen komplett an Unterwäsche und Damenhygieneartikeln. Zwei provisorische Stromstellen wurden unter freiem Himmel aufgebaut um Handys aufzuladen, Wasserkocher anzuschließen und Töpfe zu erhitzen. Deren sichere Nutzung ist aber nur bei trockenem Wetter gewährleistet. Was jedoch wird passieren, wenn es regnet und jemand in der Nähe steht, vielleicht sogar ein kleines, unwissendes Kind? Über all das wird ja endlich berichtet, darüber, dass aber kaum mehr Hilfsorganisationen vor Ort sind, wird meist geschwiegen. Ebenso darüber, dass es an ärztlicher Versorgung und Privatsphäre im Lager gänzlich fehlt. Man braucht nicht selbst Mutter oder Hebamme zu sein um die medizinische Dringlichkeit einer Frau festzustellen, die vor fünf Tagen ein Baby zur Welt gebracht hatte. Sie sitzt in einem Zelt, das nicht einmal jenes der UNHCR ist, sondern eines, wie sich Kinder im Garten aufstellen, mit eiskalten Schweißperlen auf ihrer Stirn in einem nass triefenden T-Shirt, das von dem ungehemmten Milchfluss durchtränkt wurde, und in einer von Blutlachen getränkten Hose auf dem steinigen Boden. Doch anstatt ihr zu helfen, bittet sie flehentlich darum, sich ihrem Baby anzunehmen. Das Baby liegt regungslos in ihrem Arm – nicht mehr fähig, auf einen Reflex zu reagieren. Doch damit noch nicht genug. Die junge Frau gibt die Decke, in die sie ihr Kind wickelte, beiseite und es zeigt sich ein sich über den ganzen winzigen Körper ausbreitender nässender Ausschlag. Bevor dieses verwundbar wundersame Wesen seine Augen auf dieser Welt öffnen, ja den ersten Wimpernschlag machen darf, wird es gewaltsam aus dem wunderschönen Paradies, aus dem es stammt, entrissen. Wird dieses kleine wundervolle Geschöpf jemals die Augen öffnen werden und vollkommen auf dieser Erde ankommen dürfen oder wird es schon bevor das Leben hier richtig begonnen hat, diese Erde wieder verlassen müssen? In meiner Hoffnung, sollte dieses kleine Mädchen diese Umstände nicht mehr überleben können, wird es dann unendlich sanft aufgefangen werden um vielleicht sogar von einem unmenschlichen, ausweglosen irdischen Lebensweg verschont zu bleiben? Selten fühlte ich mich so hilflos ohnmächtig in meinen Möglichkeiten. Am nächsten Tag darf ich erleben, dass das kleine so unendlich starke Baby die Nacht über hierbleiben durfte, meine hineingeschmuggelte Bepanthensalbe zeigte wohl Wirkung und der gesamte Zustand dieses Kindes verbesserte sich wesentlich. Ich bin unendlich glücklich, dass die Kleine wieder Teil des irdischen Daseins werden durfte, frage mich aber zugleich, welch unmenschlich harten Boden ihre Füße während sie die ersten tappsigen Schritte versuchen werden, betreten müssen.
Meine tapfere kleine Freundin Ghazel finde ich in der Corona-Quarantäneabteilung wieder. Was muss dieses Mädchen noch alles er- und durchleben? Hat sie sich im Sommer noch aus reinster, tiefster Verzweiflung die Zähne selbst gezogen, damit die Schmerzen endlich ein Ende fanden und versorgt sie ihre Geschwister liebevollst und in einer Art und Weise, die ihr kindliches Alter weit überschreiten – ihre Mutter schwanger und an unbehandelter Epilepsie leidend und ihr Vater schwersttraumatisiert – so ist sie nun eingepfercht in einem Zelt, das sie mit acht weiteren ihr zum Teil unbekannten Personen teilen muss und jeder noch so kleine Schritt vor das extra umzäunte Gelände ist ihr verwehrt, strengstens durch die Dauerwache schiebende Polizei untersagt. Der einzige Schuh, der ihr nach dem Brand geblieben ist, ist ein viel zu großer Männerbadeschuh, auf dem sie mir stolpernd entgegen hüpft und mit ihr ihr großes liebendes Herz. Wie haltlos jung Ghazel doch ist, wie sich doch noch endlos träumen könnte, wäre sie doch nur in ein anderes Fleckchen Erde hineingeboren worden. Es scheint, als könnte ihr kein noch so schreckliches Leid ihre wundervollsten Herzenseigenschaften nehmen. Ungebrochen weltwach, weltoffen, weltverliebt. Und ihre ungestüme Neugier auf das Leben. Dafür bewundere und liebe ich dieses kleine Mädchen so sehr. Nur wird es das Leben auch nur einmal mit ihr gut meinen? Wird sie jemals überhaupt die Anerkennung als offizielles Flüchtlingskind auf Lesbos in diesem Land erhalten und dadurch einen kleinen Schritt einer besseren Zukunft entgegengehen können? Wird sie je ihren weltenhungrigen Geist stillen und die Schönheit des Daseins in einer sicheren und bedürfnisorientierten Umgebung erleben dürfen oder wird sie diese weiterhin nur als in ihrem Herzen beheimatetes Gefühl tragen ohne, dass dies beflügelt beschenkt wird und an den Wundern der Welt wachsen darf? Meine kleine Freundin ist so unbeschreiblich interessiert, begeistert zu lernen über sich und die Welt. Hatte sie im alten Lager wenigstens noch die Chance Englischunterricht zu bekommen, wurde ihr auch dieser zukunftsweisende Grundstein durch den Brand und das neue Lager wieder genommen. Dass in diesem überfüllten Zeltlager eine Quarantäneabteilung errichtet wurde, grenzt an hemmungslosen Zynismus. Es werden Menschen unterschiedlichster Stadien der Erkrankung in überfüllte Zelte gedrängt und wenn man die Mund-Nasen-Masken genauer betrachtet, scheint es, als würde jedem der Erkrankten genau eine solche Maske für die Gesamtdauer der Quarantäne zur Verfügung stehen. Es gibt keine ärztliche Betreuung, während man gleichzeitig aber alle Menschen in Zelten unterbringt, die offiziell Platz für vier Personen haben, in diesem neuen Moria jedoch mindestens Platz für acht Personen bieten müssen, in denen die Geflüchteten Wind und Wetter schutzlos ausgeliefert sind. Dem besten Nährboden sich sämtliche Erkältungskrankheiten, Lungenentzündungen einzufangen und sich gegenseitig anzustecken. Auch dieses Schicksal und die dazugehörige Verantwortung werden bewusst weiterhin in die blutweißen Hände Europas gelegt und von diesen auch noch getragen.
Der Irrsinn, der von den Verantwortlichen hungerstillend genährt wird, macht keine Pause. Die nächste Runde beginnt. Ich finde das Zelt, in dem die 86-jährige Frau nun leben muss. Finde sie in der Ecke des Zeltes mit schmerzverzerrtem Gesicht und ihren erloschenen, todtraurigen Augen auf dem kahlen und kalten Boden sitzend vor. Auch ihre Tochter und ihr Neffe sind bei ihr. Sie erzählen mir, dass der Neffe Farzahl nachdem er die „Grandmother“, wie sie liebevoll genannt wird, während der Flucht Huckepack nachts über die Berge im Iran trug, die alte Dame nun auch noch vor dem sicheren Tod im Feuer selbstlos gerettet hat, sie auf dem Rücken aus dem brennenden Lager durch den Haupteingang rennend hinaustragen wollte. Die Polizisten jedoch schlossen die eisernen Türen des Haupteingangs, versperrten dadurch den Hauptfluchtweg und schossen auf die in größte Panik geratenen Menschen mit Tränengas und Wasserwerfern. (Dies bestätigten mir später so viele weitere Menschen und zeigten mir Videoaufnahmen davon). Also floh Farzahl mit seiner Tante auf dem Rücken über die steilen Olivenhaine, riskierte sein eigenes Leben, um das Leben seiner Tante zu retten, stellte deren Leben altruistisch über sein eigenes. Nun aber tauchen plötzlich zwei Frauen vor ihrem Zelt auf, fordern die Tochter und „Grandmother“ auf, ihre Sachen zu packen. Sie dürfen heute Abend noch in ein Haus nach Mytilini ziehen, aufgrund der Vulnerabilität der alten gebrechlichen Frau, wie sie erzählen. Ich bin fassungslos überrascht – woher kommt so plötzlich und doch viele Jahre zu spät die Einsicht, dass man besonders schutzbedürftige Personen aus dieser Hölle befreien muss? Die beiden Frauen in ihren Gefühlen so überwältigt, von ihnen mit voller Wucht überrannt, wissen nicht mehr wie es um sie geschieht. Doch nun nimmt der Wahnsinn seinen Lauf. Die beiden Frauen werden abgeholt, Fahrzal, der Neffe muss im Lager wohnen bleiben, denn er ist kein Verwandter ersten Grades und gehört somit nicht zur Familie, ist kein Mitglied dieser. Wer in aller Welt hat das Recht zu entscheiden, dass ein junger Mann, der alles Menschenmögliche getan hat, um das Leben eines anderen zu retten, kein Familienmitglied sei? Wer überhaupt kann so engstirnig denken und die Ansicht vertreten, Familie definiere sich nur durch jenes Blut, das jemand direkt mit dem anderen teilt? Den Dreien bleibt keine Chance, diesen unfassbaren Schock zu verdauen, sich voneinander gebührend zu verabschieden, denn die beiden Frauen werden sogleich abgeholt und in die Stadt gebracht – in totaler Unwissenheit gelassen, ob sie sich jemals wieder zu dritt sehen werden können, bevor die 86-jährige Frau das Ende ihrer Zeit auf dieser Welt erreicht haben wird. Jedes Mal, wenn ich denke, die Menschen wären zu nichts Grausameren mehr fähig, verdeutlicht mir dieses Lager den Gegenbeweis. Die Geflüchteten wollen doch einfach nur teilhaben an der Welt, an einer Welt in Sicherheit und Frieden. Stattdessen aber trennt man Menschen, die zueinanderstehen und das Leid, das man ihnen immer wieder aufs Neue antut, gemeinsam und füreinander durchstehen, voneinander in unheimlicher Eiseskälte, in der nicht ein Funken Empathie erglühen kann. Wahrscheinlich denken diejenigen, die noch nicht einmal verantwortlich dafür sind, sondern nur gehorsam das ausführen, was ihnen aufgetragen wird, nun auch noch etwas Gutes getan zu haben, indem sie besonders bedürftige Menschen aus dem Lager gerettet haben. Es ist ein Anfang, dass besonders Hilfsbedürftige an einen sichereren Ort gebracht werden, aber doch nicht in einem rein theoretisch festgelegten Aspekt, der jegliche emotionale Wichtigkeit und Verbundenheit ausschließt. Nun wird sich fadenscheinig für Familien, behinderte, kranke und alte Menschen eingesetzt. Nur aber, was passiert mit den zurückgelassenen wie Fahrzal oder mit jungen Menschen, die die Volljährigkeit erreicht haben und ohne Eltern strandeten? An diese Betroffenen wird nicht ein Gedanke verschwendet, sie werden in ihrem Elend noch gedemütigter und alleingelassen und immer öfter ist der einzige Ausweg der Suizid. Dem eigenen Leben auf europäischen Boden ein Ende setzen zu müssen nach all dem ungeheuren Leid, das sie oftmals schon zu Hause und dann weiter auf dem Fluchtweg ausgehalten und überstanden haben, das zeugt von einem enormen, unbeschreiblich menschenverachtenden Armutszeugnis eines bluttriefenden Europas.
Der dritte Besuch: vom 18. bis 22. Oktober 2020
Vier Wochen später verschärft sich die Situation zusehends. Traten die Polizisten anfangs noch fast unbewaffnet und respektvoll den Geflüchteten gegenüber, schienen an Deeskalation und Frieden interessiert zu sein, verhafteten mich bei der einen oder anderen aufgeflogenen Schmuggelei an unzähligen Bepanthen-Tuben, Schmerzmitteln und Winterklamotten nicht, sondern lächelten mich sogar noch zum Teil wohlwollend an, drehten sich um und hatten offiziell nichts gesehen, so herrscht nun der allzeit bekannte harsch, autoritär schreiende Ton. Unbemerkt ins Lager hineinzugelangen ist nun schier unmöglich und sollte jemand erwischt werden, drohen den Geflüchteten, die sich in der Nähe befinden ebenso eine gewaltige Konsequenz. Auch die campinterne Maffia hat mit ausgebreiteten Fangarmen wieder Fuß gefasst. „Team Humanity“ diesen namentlich empathischen Deckmantel streifte sie sich nun glänzend über und ich entdecke den jungen syrischen Mann als deren Mitarbeiter. Ich frage ihn nach seinem kleinen tierischen Freund, er bittet mich um einen Augenblick Geduld, geht und kommt in Begleitung des prächtig sich entwickelnden Welpen wieder zu mir zurück. Sogleich leuchten seine Augen wie grüne Smaragde in die Welt, so als würden sie wollen, dass man an diesen ihren Wundergaben teilnimmt. Ich weiß aber angesichts seiner neuen Situation nicht, ob ich erleichtert darüber sein sollte, ihn gesund und am Leben seiend in einer ihm den Eindruck einer sinngebenden Aufgabe vorgaukelnden Arbeit vorzufinden oder ob ich im Hinblick auf seine Zukunft nun in eine andere Angst als noch einige Wochen zuvor, verfallen sollte. „Team Humanity“ hat sich auf der gegenüberliegenden Seite ein altes, zuvor unbetretenes Gelände erhascht, auf dem sie offiziell Klamotten an andere Geflüchtete verschenken. Doch nachdem ich einen der ehemaligen Mafiabosse, der im internen Prostitutionsring tätig war, erkannt habe, will ich dem Ganzen nicht den geringsten Glauben schenken. Ich spreche einen „Mitarbeiter“ an und erkundige mich nach ihrer Aufgabe. Er leitet mich an seinen Boss weiter -ein ca. 20-jähriger Afrikaner, der mich mit dem Vorwurf des Rassismus konfrontiert, weil ich verwundert bin, dass er der Chef ist. Natürlich nicht wegen seiner Herkunft, sondern eher wegen seinem pubertären Auftreten. Ich frage scheinheilig, ob man sie durch Kleiderspenden unterstützen könnte. Er müsse dies erst mit dem obersten Chef besprechen, dieser sei aus Dänemark, könne nicht mit mir persönlich reden, da es ihm an Kenntnissen der englischen Sprache fehle. Ein Däne, der kein englisch spricht? Schier unmöglich! Zeitgleich erlebe ich, dass eine schwarze Frau am „Eingang“ abgewiesen wird und ich spreche den pubertären „Boss“ auf seinen vorhin geäußerten Vorwurf des Rassismus an und frage, ob er nicht genau diesen nun real werden ließ, noch dazu als jemand, der selbst eine der dunkelsten Hautfarben habe. Er ignoriert mich, wirft mich hinaus. Ich treffe weitere Frauen auf der Straße und frage sie, ob sie hier Klamotten kostenlos erhalten würden. Die eine der drei Frauen verfällt in hysterisches Lachen, zeigt mir ein handgeschriebenes „ticket“, das sie im Lager von einem dieser Herren kaufte, um dann ein Stück Kleidung abholen zu dürfen. „Team Humanity“, der neue Fachbereich der campinternen Mafia schickt also Geflüchtete als leibeigene Mitarbeiter zu deren Leidensgenossen, um Tickets für eine Jacke oder eine Hose zu verkaufen. Später erfahre ich noch von einer Freundin aus Wien, dass der angebliche Däne – der oberste Boss – ein Afghane mit anerkanntem Asylstatus in Dänemark ist, teilweise in Griechenland wohnte, dann aber des Landes wegen Menschenhandels verwiesen wurde und nun wieder in Dänemark sei. Jetzt leuchtet mir auch ein, wieso es nicht möglich war mit ihm zu sprechen. Er ist ja gar nicht da, hat aber wohl alle Fäden in seiner Hand. Menschen wie der junge syrische Mann werden in ihrer sich abzeichnenden Zukunftslosigkeit Gefangene hoch krimineller und skrupelloser Geflüchteter und dadurch unwissend oder auch wissend, sich aber in absoluter Perspektivlosigkeit befindend, zu Tätern gegenüber ihren Mitmenschen, mit denen sie sich vielleicht sogar noch ein Zelt teilen müssen.
Ich weiß nicht, ob es richtig ist, einem einzigen Kind einen Tag der Sorglosigkeit zu schenken, aber an meinem letzten Tag nach all dem jede Zelle meines Körpers durchdrängenden erlebten Leid, tat ich es. Ich versprach Ghazel in den Wochen zuvor, als ich sie in diesem elendigen Quarantäneareal vorfand, dass wir uns wiedersehen und einen Tag gemeinsam verbringen werden. So fand ich sie dieses Mal nun glücklicherweise wieder – zu diesem Zeitpunkt durften sie das Lager noch verlassen – und ich nahm sie mit in die Stadt. Sie entdeckte auf dem Weg zum Auto eine Schnecke, strahlte über das ganze Gesicht, hob sie ganz vorsichtig vom Boden hoch und ließ sie auf ihrer Hand kriechen. Sie war fasziniert gefesselt von diesem kleinen Tierchen und allein dies war von himmlischer Verzückung für uns Beide. Angekommen in der Stadt, war sie ganz und gar ihrer Herzensfreude erlegen und ihre hellwachen Augen strahlen mit der Sonne um die Wette als sie am Hafen zum Wasser gehen kann und eine Muschel findet. Ich frage sie spaßeshalber, ob sie diese essen wird, sie sieht mich an, sagt „no!!“ und zeigt mir ihre Perlenhalskette. Für sie trägt die Muschel also eine Perle ihrer Kette in sich. Wir sind so beflügelt, mit bedingungsloser Freude glückselig beladen. Dieser Moment ist ewig atemberaubend sinnig, getragen von himmelsnaher Verzückung und plötzlich ist der Himmel in seiner Wirklichkeit so nah und die Realität für Augenblicke unendlich fern.
Hätte der sechsjährige Junge, den man kürzlich zusehends vor der Küste Lesbos ertrinken ließ und dessen Vater nun in wahnwitziger, zu tiefst verachtender Weise wegen vorsätzlicher Gefährdung mit Todesfolge angeklagt wurde, diese wundersamen, kindlichen Momente der Wirklichkeit auch erleben können, hätten wir nicht alle erhobenen Hauptes über die sich ereignende Tragödie, die nie ein Einzelfall war und so befürchte ich, auch nicht das letzte hoch Ereignis, das so einfach vermeidbar wäre, dort sein wird, hinweggesehen?
Wohin aber wird uns der grenzenlose Egoismus unserer westlichen Gesellschaft noch führen, wenn wir nicht endlich erkennen, dass wir alle eins sind und uns nur gemeinsam zum Guten wenden können oder eben mit unserem selbst erschaffenen Kartenhausimperium untergehen werden? Eines Tages, wenn es dann hoffentlich nicht schon zu spät ist, werden wir aufwachen und wissen: Wir alle sind Mosaiksteinchen des großen Ganzen. In unseren Eigenschaften ganz verschieden, in unserer Gestalt und Größe jedoch ganz gleich groß. Niemand ist größer oder schöner. Wir alle brauchen jeden Einzelnen von uns in seiner wunderbaren Einzigartigkeit, um uns zu einem Gemälde zusammenfügen zu können in einem uns haltenden Rahmen. Da Vincis Gemälde, Beethovens Symphonien, Rilkes Gedichte – sie brauchen keinen Rahmen, wir als Menschheitsfamilie jedoch sollten uns darin einfügen, denn ohne ihn wären wir nur zusammengefügte Teile ohne Halt. Und dieser unser Rahmen ist bedingungslose Liebe und grenzenloser Respekt zueinander, niedergeschrieben als Menschenrecht. Unser Glück, an diesem wunderbaren Fleckchen Erde geboren worden sein zu dürfen, ist niemals unser eigener Verdienst, auch nicht die Anbetung der Asche, sondern die Weitergabe des Feuers. Wir glimmen – aber brennen, ja lodern? Lasst uns unser unergründliches Menschenherz vollkommen öffnen und im Sein und miteinander verbinden. Nur so werden wir die Welt für andere und somit für uns alle noch zum Guten wenden können, denn wenn wir ehrlich zu uns sind, so müssen wir uns eingestehen, dass wir keine Flüchtlingskrise haben, sondern eine Krise der Solidarität, der Empathie, eine humanitäre Katastrophe, ausgelöst durch Rassismus, Kriege und Machtgier, Klimaerwärmung, Corona und dass der Ausgang politischer Wahlen einen gemeinsamen Kern ihres dramatischen Ursprungs haben, den es durch die Liebe, die als Feuer lodernd tief in uns allen wohnt, zu schmelzen gilt, um dann eine neue Welt des liebevollen grenzenlosen Miteinander, weil wir alle eins sind, zu erschaffen, bevor es zu spät ist und niemand mehr entkommen wird, hätte er auch noch so viel Geld in seinem Koffer. Lasst uns ein Gedächtnis für das Vergessen erwecken und endlich unserem Innersten folgend handeln! Und sei es ein noch so kleiner Schritt, er ist so unendlich wichtig, denn es muss endlich der erste klitzekleine Schritt gegangen werden, sodass am Ende des Tunnels das Licht der Zukunft greifbar nah für alle Menschen dieser Welt aufblitzen können wird!
„Jeder Tag und jede Stunde, die vergeht –
unser Leben vergeht mit ihr wie der Wind.
Ich weiß nicht, was das Leben mit uns gemacht hat.
Ich weiß nur, das Gute wurde vergebens verschwendet.“
Ein Gedicht von R., 19 Jahre alt und aus Afghanistan, nun in Lesbos – eine der wundervollsten jungen Frauen, die mir jemals begegnet sind.